Die Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin gehört mit insgesamt ca. 120 Betten zu den größten Lungenkliniken in Norddeutschland. Von 32 Ärztinnen und Ärzten werden hier ca. 7.000 Patienten stationär und ca. 2.000 Patienten ambulant beziehungsweise in der Notaufnahme der Klinik versorgt. Zu unserem Krankheitsspektrum gehören neben Asthma bronchiale, COPD und Lungenemphysem die im Weiteren aufgeführten Schwerpunkte.
Willkommen in der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin

Im LKZ kooperiert unsere Klinik eng mit der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie. Pro Jahr werden hier ca. 400 Patienten mit Bronchialkarzinom neu diagnostiziert und therapiert. Zusätzlich betreuen wir jährlich ambulant und stationär ca. 2.000 Patienten mit Karzinomen der Lunge in den unterschiedlichen Krankheitsstadien. In der wöchentlich stattfindenden interdisziplinären Tumorkonferenz werden die individuellen Therapiekonzepte auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse von Expertinnen und Experten der beteiligten Fachkliniken und Institute erarbeitet. Wenn Karzinome bestimmte molekularbiolgische Voraussetzungen erfüllen, behandeln wir vor allem in der Ambulanz unserer Klinik mit modernen Antikörpern und Immuntherapeutika.
Zertifiziertes Beatmungszentrum

Das Beatmungszentrum zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Expertise mit überregionalem Einzugsgebiet aus. Neben der allgemein internistischen Intensivstation verfügen wir über eine eigene auf Respiratorentwöhnung spezialisierte Intensivstation (die sogenannte „Weaningeinheit“). Zurzeit behandeln wir hier ca. 100 langzeitbeatmete Patienten pro Jahr. In einer zusätzlichen Station für außerklinische Beatmung arbeitet ein spezialisiertes Team aus Ärzten, Atmungstherapeuten und Pfl egekräften, das über langjährige Erfahrung mit der Maskenbeatmung bei Patienten mit chronischer Atmungsinsuffizienz verfügt. Jährlich werden über 200 Patienten neu auf eine Beatmung eingestellt und bei ca. 900 Patienten wird die Beatmungsqualität kontrolliert.
Zertfikat Weaning-Zentrum der Deutschen Gesellschaf für Pneumologie und Beamtungsmedizin
Zertifiziertes Schlaflabor
Unser Schlaflabor verfügt über sieben polysomnografische Messplätze und zusätzlich zehn polygrafische Messgeräte zum mobilen Einsatz. Schwerpunkte der Diagnostik sind Schlafapnoe oder andere Atmungsstörungen im Schlaf.
Arbeitsgruppe Interstitielle Lungenerkrankungen (AGIL)
Durch neue Entwicklungen vor allem in der bildgebenden Diagnostik, aber auch spezifische Pharmakotherapien mit hoffnungsvollen Ergebnissen hat die Bedeutung der interstitiellen Lungenerkrankungen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Zur Arbeitsgruppe Interstitielle Lungenerkrankungen (abgekürzt „AGIL“) gehören neben Mitarbeitern unserer Klinik weitere Experten aus Radiologie, Pathologie, Rheumatologie, immunologisch-allergologischer Labormedizin und Thoraxchirurgie.
Pneumologische Infektionserkrankungen und Tuberkulose
In der Tradition der im Jahr 1907 gegründeten Heilstätte „Heidehaus“ behandeln wir im Schwerpunkt „Pneumologische Infektionserkrankungen“ vor allem Patienten mit Tuberkulose – Tendenz steigend. In unserem Schwerpunkt Endoskopie kommen alle modernen endoskopischen Diagnostik- und Therapieverfahren mit über 2.000 Untersuchungen pro Jahr zur Anwendung. Im eigenen Schwerpunkt „Endoskopische Lungenvolumenreduktion“ implantieren wir nach strenger Selektion der Patienten mit schwergradigem Lungenemphysem Ventile und Spiralen. In unserer Klinik werden ca. 1.500 Thoraxsonografien pro Jahr durchgeführt.
Herzlich Willkommen in der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin. Wir sind mit hohem medizinischen und ethischem Anspruch für Sie da.
Chefarzt Prof. Dr. med. Thomas Fühner
KRH Klinikum Siloah
Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin
Stadionbrücke 4
30459 Hannover
Termine Schlaflabor: Tel. (0511) 927 5340 Fax (0511) 927 97 5340
24/7 Hotline ECMO: (0511) 927 4129
ECMO(@)krh.de
Anmeldeformular ECMO
Hotline Weaning: (0511) 927 4624
weaning(@)krh.de
Anmeldeformular Weaning
Anmeldeformular invasive Beatmungskontrolle
Die thorakalen endoskopischen Untersuchungen in Diagnostik und Therapie stellen einen der Schwerpunkte der Klinik dar. Folgende Verfahren kommen zur Anwendung:
- 1. Spiegelung der Luftröhre und Bronchien (Tracheobronchoskopie)
- 2. Spiegelung einer Brustkorbseite (internistische Thorakoskopie)
Tracheobronchoskopie
Die Spiegelung des Tracheobronchialsystems erfolgt entweder mit dem starren Instrumentarium in Vollnarkose, oder mit dem flexiblen Fiberbronchoskop in Lokalanästhesie.
Die beiden Techniken sind keine konkurrierenden Verfahren, sondern werden je nach Indikation mit der einen oder anderen Indikation durchgeführt. Bei bestimmten Fragestellungen - zum Beispiel bei der Frühdiagnostik des Bronchialkarzinoms oder in der Tumornachsorge - wird an die normale Untersuchung eine Autofluoreszenzmikroskopie angeschlossen.
Interventionelle Untersuchungen werden bei uns unter Umständen als Narkosebronchoskopie mit starrem Instrumentarium durchgeführt. Derartige Untersuchungen sind:
- Endobronchialer Ultraschall (EBUS)
- Endoösophagaler Ultraschall (EUS)
- Fremdkörperentfernung
- Blutstillung bei Bronchial- / Lungenblutungen
- Tumorabtragung mittels Laser
- Aufdehnung (Bougierung) von Verengungen
- Einbringen tracheobronchialer Platzhalter (Stents) bei gutartigen oder bösartigen Verengungen der großen Atemwege
- Fistelverklebung
Thorakoskopie
Die Spiegelung einer Brustkorbseite erfolgt in der Regel in örtlicher Betäubung unter Analgosedierung beim spontan atmenden Patienten. Ungeklärte Flüssigkeitsansammlungen im Brustkorb, entzündliche Erkrankungen und Geschwulsterkrankungen des Rippenfells lassen sich mit dieser Untersuchung klären. Therapeutisch wird das Verfahren angewendet bei der Sanierung von Rippenfellvereiterungen (Pleuraempyem), der Ausräumung großer Blutansammlungen (Hämatothorax) oder zur Verklebung des Pleuraspaltes (Pleurodese), zum Beispiel bei immer wieder nachlaufenden Ergüssen.
Sonographisch gesteuerte Eingriffe am Brustkorb
Seit vielen Jahren haben wir große Erfahrung mit sonographisch gesteuerten Eingriffen am Brustkorb. Die Untersuchungsbedingungen für den Ultraschall sind am Brustkorb begrenzt, weil die Knochen (Rippen, Brustbein, Wirbelsäule, Schulterblatt) "im Wege" sind und auch die gesunde Lunge eine sonographische Darstellung verhindert. Aber wir untersuchen ja nicht gesunde Organe, sondern erkrankte. Lungenentzündungen und Tumoren, die bis an die Brustwand heranreichen, können durch Sonographie sehr gut dargestellt werden, sodass eine diagnostische oder therapeutische Punktion wesentlich einfacher und schneller durchgeführt werden kann, als mit Hilfe der Computertomographie, - vor allem entfällt aber dabei die Strahlenbelastung.
Die Möglichkeiten der sonographisch gesteuerten Punktion beschränken sich aber nicht nur auf periphere Lungenprozesse und Rippenfellerkrankungen. Auch die Lymphknoten im Mittelfellraum (Mediastinum) und Erkrankungen der Thymusdrüse lassen sich durch sonographische Diagnostik klären wie auch Erkrankungen von Brustbein und Rippen. Der Nachweis von Rippenfell-Erguss (Pleuraerguss) gelingt mit keinem bildgebenden Verfahren so sicher wie mit der Sonographie. Auch bei der Drainage-Behandlung von Rippenfellvereiterungen (Pleuraempyem) ist die Sonographie weitaus einfacher, schneller, überall verfügbar und vor allem besser als die bekannten Röntgenverfahren.
Im Bereich der bildgebenden Verfahren besteht neben der Nutzung des diagnostischen Spektrums der Pneumologie eine enge Zusammenarbeit mit der Klinik für Radiologie und interventionelle Angiologie.
Viele akute und chronische Erkrankungen können zu einer Beeinträchtigung der Atemmechanik und des Gasaustausches der Lunge führen, so dass ein eigenständiges Atmen nicht mehr möglich ist und maschinell unterstützt werden muss. In unserem Beatmungszentrum bieten wir die Möglichkeit, alle Stadien beatmungspflichtiger Erkrankungen zu therapieren und unsere Patientinnen und Patienten über den gesamten Krankheitsverlauf umfassend zu begleiten.
Intensivstation
Auf der interdisziplinären Intensivstation können alle akut internistischen Erkrankungsbilder mit großer Expertise und umfassender Maximaltherapie behandelt werden. So werden auf der pneumologischen Intensivstation alle gängigen invasiven und nicht invasiven Beatmungs- sowie Highflow- Verfahren durchgeführt. Bei schwerem Lungenversagen setzen wir regelmäßig das extrakorporale Lungenersatzverfahren (ECMO) ein. Unsere Klinik ist in das ARDS Netzwerk eingebunden.
Kardial führende Erkrankungen werden auf der kardiologischen Intensivstation umfassend therapiert, eine 24/7 Herzkatheterbereitschaft steht zu Verfügung. In Kooperation mit der Nephrologie mit großer seperater Dialyseeinheit können alle gängigen Nierenersatzverfahren und Plasmapherese angeboten werden. Eine Weiterbildungsbefugnis für die Zusatzbezeichnung „internistische Intensivmedizin“ ist vollumfänglich (48 Monate) vorhanden.

Pflegerinnen, Physiotherapeutinnen, Atmungstherapeutinnen und Ärztinnen der Weaning-Station
Weaningeinheit
Nach akutmedizinischer Stabilisierung und bei fortbestehender Ateminsuffizienz mit Abhängigkeit vom Respirator erfolgt die Verlegung in unsere spezialisierte Weaningeinheit. In das nach DGP zertifizierte Weaningzentrum werden regelmäßig überregional Patienten zur Entwöhnung vom Respirator übernommen. Insgesamt werden pro Jahr bis zu 100 Patienten erfolgreich von einer bestehenden Langzeitbeatmung entwöhnt. Auch über die Zeit im Weaningzentrum hinaus werden die Patienten in regelmäßigen stationären Kontrolluntersuchungen über Jahre hinweg begleitet.
Heimbeatmungsschwerpunktstation
Sollte nach einer Beatmungsentwöhnung eine Maskenbeatmung erforderlich sein, erfolgt die Verlegung auf unsere Beatmungsschwerpunktstation. Unsere Patientinnen und Patienten werden an die Handhabung und Nutzung des Beatmungsgerätes Schritt für Schritt herangeführt bis eine Entlassung in die Rehabilitation oder Häuslichkeit möglich ist.

Schlafmedizin und Heimbeatmung sind eng miteinander verbunden. Das Schlaflabor ist ein wichtiger Bestandteil der Abteilung für Pneumologie des KRH Klinikums Siloah.
Die wichtigste und wesentlichste Untersuchungsmethode im Schlaflabor ist die nächtliche Polysomnografie. Dabei werden mittels Sensoren Messparameter von Atmung, Kreislauf, Hirn-, Muskelaktivität, Augenbewegungen, Schlafarchitektur und Schlaftiefe sowie nächtlicher Beinbewegungen, Atempausen (Apnoen), Schnarchen, Herzrhythmus und die nächtliche Funktion der Atmung abgeleitet.
Unser Schlaflabor umfasst sieben polysomnografische Messplätze. Es werden im Wesentlichen folgende Erkrankungen bzw. Störungen diagnostiziert und behandelt:
Schlafstörungen
Zu den Schlafstörungen zählen u.a.:
- Ein- und Durchschlafstörungen (Insomnien)
- Nächtliche Beinbewegungen/unruhige Beine (restless legs)
Schlafstörungen können eine unterstützende medikamentöse Therapie, Verhaltensänderungen (sog. schlafhygienische Maßnahmen und Maßnahmen zur Stimuluskontrolle) sowie eine begleitende neurologisch-psychologische Betreuung der Patienten erfordern.
Schlafbezogene Atmungsstörungen
Zu den schlafbezogenen Atemstörungen zählen:
-
Krankhaftes (obstruktives) Schnarchen
-
Obstruktives Schlafapnoesyndrom
-
Hypoventilationssyndrome und Erkrankungen der Atempumpe
-
Atemregulationsstörungen und periodische Atmung
Obstruktive Schlafapnoe
Der Schwerpunkt des Schlaflabors liegt im Bereich der Behandlung von Atmungsstörungen im Schlaf. Dazu gehört insbesondere die so genannte „Schlafapnoe“, d.h. kurze wiederkehrende Atempausen im Schlaf, die sich akustisch durch lautes Schnarchen im Wechsel mit Atempausen (sog. „Apnoen“) bemerkbar machen.
Die Atemstillstände während des Schlafes können in Extremfällen 60 Sekunden und länger dauern und sich 300 bis 400 mal pro Nacht ereignen. Der hiermit verbundene Sauerstoffmangel und starke Druckschwankungen im Brustkorb bedeuten für den Körper höchste Alarmstufe. Stresshormone werden ausgeschüttet, der Blutdruck steigt an, bis diese Krise schließlich wieder durch tiefes Durchatmen, begleitet von lautem Schnarchen beendet wird.
Bei zunächst organisch gesunden Menschen können diese Stresssituationen, ohne zunächst bewusst zu werden, zu einer starken körperlichen und später auch mentalen Belastung führen. Vom sozialen Umfeld oft als störende Geräuschbelästigung wahrgenommen, sind diese Schlaf- und Atmungsstörungen ein häufiger Grund für Tagesschläfrigkeit, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen und weitere unspezifische Symptome.
Im späteren Krankheitsverlauf kann eine unbehandelte Schlafapnoe wesentliche Ursache für erhöhten Blutdruck, Herzinfarkt und Schlaganfälle sein.
Wie lässt sich eine diagnostizierte Schlafapnoe therapieren?
Entscheidend ist, den im Schlaf kollabierenden Rachenbereich zu öffnen. Hierzu wird über eine weiche (Mund-)Nasen-Maske mit Hilfe eines Überdruckes (5-15 cm H2O), eine pneumatische Schienung des kollabierten Bereichs und damit eine Normalisierung der Atmung im Schlaf erreicht.
Auch alternative Therapieverfahren mit entsprechend ausführlicher Beratung des Patienten werden insbesondere bei leichtgradigen Befunden in fachübergreifender Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten angeboten.
Atemregulationsstörungen
Atemregulationsstörungen (z.B. periodische Atmung bei Herzinsuffizienz) machen eine nächtliche Beatmung mit komplizierten Mess- und Regelmechanismen erforderlich.
Erkrankungen mit Erschöpfung oder Überlastung der Atempumpe machen den Einsatz "höherwertiger Positivdruckbeatmungsverfahren" notwendig. In der Diagnostik derartiger Erkrankungen sowie der Einleitung entsprechender Beatmungsverfahren liegt insbesondere die Stärke unserer Abteilung incl. Schlaflabor.
Tagesschläfrigkeit
Tagesschläfrigkeit (Tagesmüdigkeit) kann verschiedene Ursachen haben. Häufig ist eine Störung der Schlafqualität die Ursache für diese Beschwerden. Nächtliche Atmungsaussetzer, d.h. Apnoen im Schlaf oder dauerhaft unzureichende Atmung im Schlaf bei fortgeschrittenen Lungenerkrankungen, aber auch andere Erkrankungen wie z.B. periodische Beinbewegungen, internistische Erkrankungen, wie z.B. Stoffwechselstörungen etc. führen zur besagten Symptomatik.
In unserem Schlaflabor erkennen wir die nächtlichen Unterbrechungen der Atmung und Beeinträchtigung der Schlafqualität. Durch Untersuchungen am Tage können wir eine erhöhte Einschlafneigung und verminderte Konzentrationsfähigkeit mit speziellen Methoden messen. Bei Nachweis von Atmungsstörungen im Schlaf wird ebenfalls im Schlaflabor die Therapie der Wahl, oft die Überdruckbeatmung über eine Maske, begonnen.
Bei komplexen Krankheitsbildern ist es oft sinnvoll, die Symptome fachübergreifend gemeinsam mit anderen Disziplinen wie z.B. Neurologen oder HNO-Fachärzten, zu therapieren.
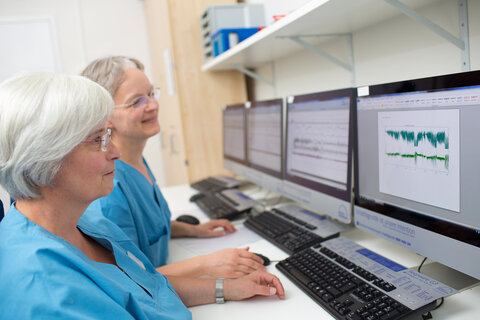
Als zweiten Schwerpunkt hat sich das Schlaflabor gemeinsam mit der Station B03 auf die Behandlung von Patienten mit schwergradiger Atmungsschwäche spezialisiert. Während bei Patienten mit geschwächter Atemmuskulatur infolge Erkrankungen der Lunge und Atemwege, des Brustkorbes oder der Muskulatur die Atmung am Tag zunächst noch ausreichend ist, verschlechtert sich die Atmung bei ihnen häufig während des Schlafes, und nicht selten versterben diese Menschen nachts im Schlaf. Diese Gefahr besteht übrigens auch bei Patienten mit Herzmuskelschwäche. Bei frühzeitiger Erkennung und Beatmungstherapie der für dieses Krankheitsbild typischen periodischen Atmung lässt sich die Sterberate der Herzkranken vor allem während des Schlafes nachhaltig positiv beeinflussen.
Ist bei chronisch kranken Patienten die Ermüdung der Atemmuskulatur die Ursache der Beschwerden, so ist die so genannte „Heimbeatmung“ die Therapie der Wahl. Ebenfalls unter Verwendung einer Atemmaske müssen wir dann die Atemmuskulatur maschinell unterstützen, gegebenenfalls sogar komplett ersetzen. Für die Heimbeatmung stehen in der Klinik spezielle Beatmungsgeräte und -verfahren zur Verfügung. Mit der Überdruckbeatmung lassen sich in vier von fünf Fällen die Probleme deutlich bessern.
Mehrere Nervenerkrankungen, Muskelerkrankungen oder Lungenerkrankungen können zur Schwäche oder chronischer Überbelastung der Atempumpe führen:
- Nervenerkrankungen
- Amyotrophe Lateralsklerose
- Spinale Muskelatrophie
- Zwerchfelllähmung
- Muskelerkrankungen
- Muskeldystrophie
- Lungenerkrankungen
- Chronisch Obstruktive Bronchitis (COPD)
- Übergewicht
- Obesitas-Hypoventilation (Pickwick-Syndrom)
- Erkrankungen des Brustkorbs und Stützaparates
- Skoliosen und Kyphoskoliosen
- Postpoliosyndrom
- Verschwartungen des Rippenfells
- Pleuraschwarte
- Post-TBC-Syndrom
Diagnostik
Zur Diagnosestellung derartiger Erkrankungen ist eine umfangreiche Diagnostik einschließlich einer subtilen Beurteilung der Lungenfunktion erforderlich. In unserer Lungenfunktionsabteilung werden umfassende Untersuchungen der verschiedenen Lungenfunktionsparameter durchgeführt:
- Spirometrie
- Ganzkörperplethysmographie
- Diffusionskapazität
- Blutgasanalyse
- Belastungstests
- ggf. Rechtsherzkatheter
Therapie
Auf der spezialisierten pneumologischen Station 2c sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Schlaflabor werden die Patienten auf die Heimbeatmung eingestellt. Für die aufwendige Anpassungszeit werden in der Regel sieben bis zehn Tage benötigt. Unter Anleitung fachkompetenter Ärzte, technischer Mitarbeiter und der Pflegekräfte lernen die Patienten und Angehörigen den Umgang mit Beatmungsmasken und -geräten.
Die besondere Herausforderung für die Patienten ist hierbei, ihre eigene Atmung an das Beatmungsgerät anzupassen oder sich sogar vollständig dem Gerät unterzuordnen und der Maschine die Steuerung dieser Vitalfunktion zu überlassen. Die meisten Patienten verwenden die Beatmung im Schlaf während der Nacht. Mit zunehmendem Schweregrad der Erkrankung wird die Maskenbeatmung zusätzlich stundenweise am Tag durchgeführt.
Ziel der therapeutischen Maßnahmen, die im Schlaflabor zur Verfügung stehen, ist es, durch Normalisierung der Atmung einen tiefen und erholsamen Schlaf zur Erholung von Geist und Körper zu erreichen. Patienten mit Atmungsschwäche infolge chronischer Lungenerkrankungen und Muskelerkrankung erholen sich mit Hilfe der Heimbeatmung innerhalb weniger Wochen erstaunlich, es kommt zur deutlichen Zunahme der körperlichen Aktivität, Besserung der Lebensqualität und Reduktion der zuvor häufig notwendigen Krankenhausaufenthalte.

Infektiöse Erkrankungen der tiefen Atemwege und der Lunge werden durch Bakterien, Viren (selten), Pilze und - in unseren Breiten sehr selten - durch Parasiten verursacht. Wegen des unterschiedlichen diagnostischen und therapeutischen Vorgehens wird zwischen außerhalb des Krankenhauses und im Krankenhaus entstandenen Lungenentzündungen unterschieden. Mehr als zwei Drittel aller Lungenentzündungen entstehen außerhalb des Krankenhauses. Von diesen Patienten muss aber wegen der Schwere der Erkrankung letztlich jeder vierte im Krankenhaus behandelt werden. Bei unkompliziertem Verlauf ist eine Lungenentzündung in zwei bis drei Wochen ausgeheilt. Schwerkranke Patienten werden auf unserer Intensivstation behandelt und gegebenenfalls vorübergehend künstlich beatmet.
Eine Sonderform der Infektionskrankheiten stellt die Tuberkulose dar. Sie kann grundsätzlich jedes Organ befallen. 80% der Erkrankungen betreffen jedoch die Lunge und/oder das Rippenfell. Lymphdrüsen, Nieren und Geschlechtsorgane, Knochen und Gelenke sowie die Hirnhäute sind die häufigsten Manifestationsorte außerhalb der Atmungsorgane. Die Zahl der Neuerkrankungen an Tuberkulose hat in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. (Weltweit ist die Tuberkulose aber unverändert die häufigste Infektionskrankheit!).
An Tuberkulose erkrankte Patienten werden auf unserer Infektionsstation behandelt und sind in Einzelzimmern untergebracht, solange sie die Erreger abhusten und damit ihre Umgebung gefährden. In der Regel besteht nach vier Wochen medikamentöser Behandlung keine Ansteckungsfähigkeit mehr und die Isolierung kann aufgehoben werden. Mit den heutigen modernen Medikamenten (Antituberkulotika) kann nahezu jede Tuberkulose geheilt werden. Voraussetzung hierfür sind richtige Dosierung und regelmäßige Einnahme der Medikamente.
Schwierigkeiten sind in den letzten Jahren durch zwei Entwicklungen entstanden: Zum einen nimmt die Zahl der Patienten zu, die gleichzeitig an Tuberkulose und AIDS erkrankt sind. Die Abwehrschwäche dieser Patienten erschwert oft die Therapie der Tuberkulose und vermindert gleichzeitig die Erfolgsaussichten einer erfolgreichen Tuberkulosebehandlung.
Zum anderen nimmt – bedingt durch Migrationsströme aus Osteuropa und Asien – die Zahl der Tuberkulosen zu, bei denen zwei oder mehr der antituberkulotischen Medikamente von Beginn an unwirksam sind (multi drug resistance = MDR). Diese Patienten stellen ein besonderes Infektionsrisiko dar, die Behandlung ist schwierig, langwierig und kostenintensiv.
Asthma bronchiale ist eine chronisch entzündliche Atemwegserkrankung, die vorwiegend durch Allergene, körperliche Anstrengung, sowie auch durch Medikamente verursacht werden kann. Durch die Entzündung kommt es zur Verengung der Atemwege, was zur Luftnot führt. Typisch für Asthma ist, dass der Grad der Atemnot sowie die Häufigkeit des Auftretens der Atemnot stark variieren kann. Im Vergleich zu Gesunden sind beim Asthmatiker die Atemwege sehr empfindlich und reagieren sensibel auf Umwelteinflüsse.
Etwa zehn Prozent der Kinder leiden an Asthma bronchiale oder haben ein nachweislich überempfindliches Bronchialsystem. Etwa fünf Prozent der Erwachsenen haben die Diagnose Asthma bronchiale.
Die Ursachen des Entstehens des Asthma bronchiale sind noch nicht vollständig erklärt. Sicher ist allerdings, dass neben erblichen auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Im Wesentlichen sind Entzündungszellen sowie zahlreiche Botenstoffe für Entstehung und Unterhaltung der Atemwegsentzündung und des Asthma bronchiale verantwortlich.
Durch bestimmte Lungenfunktionsprüfungen lässt sich das Asthma bronchiale nachweisen. Durch antientzündliche Medikamente, die die Atemwegsentzündung hemmen, sowie bronchialerweiternde Medikamente, die zur Entspannung der Bronchialmuskulatur und Erweiterung der Atemwege führen, ist das Asthma bronchiale in der Regel gut zu behandeln.
Neue Entwicklungen in der Diagnostik und Therapie
Wesentliche Ursachen für die bedrohliche Zunahme der Atemwegserkrankungen ist das Rauchen; vor allem die zunehmende Zahl jugendlicher und weiblicher Raucher. Klima- oder berufsbedingte Umweltfaktoren sind deutlich weniger verantwortlich für diese Entwicklung. Im Gegensatz zu Krankheiten aus dem Herz-Kreislauf-Bereich, die insgesamt rückläufig sind, steigen die Atemwegserkrankungen weiter an. Die Weltgesundheitsorganisation hat errechnet, dass eine weitere Steigerung der Atemwegserkrankungen um 25% bis zum Jahre 2020 zu erwarten ist.
Es wird in den nächsten Jahren zur Steigerung der Todesursachen durch chronische Atemwegs- und Lungenerkrankungen, Emphysem, chronisch obstruktive Bronchitis kommen. Die COPD wird laut WHO-Analysen für das Jahr 2020 Platz 3 der "Hitliste" der 10 häufigsten zum Tode führenden Erkrankungen (hinter Herzkranzgefäßerkrankungen und Schlaganfall) einnehmen. Unter sozioökonomischen Aspekten sind Lungenerkrankungen von großer Bedeutung; sie verursachen ca. 20 Milliarden Euro, die zweithöchsten Kosten aller Krankheitsgruppen in Deutschland, sie werden nur noch übertroffen von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Therapie der COPD
In jüngerer Vergangenheit hat sich eine international besetzte Initiative ("GOLD", Global Initiative for chronic obstructive lung disease) mit dem Ziel konstituiert, allgemein akzeptierte Richtlinien zu Diagnostik, Schweregradeinteilung, Prävention und Therapie der COPD zu formulieren und zu verbreiten. Im Wesentlichen basierend auf der Lungenfunktion werden die Schweregrade der COPD definiert und die Differentialtherapie durchgeführt.
Hierzu gehören Inhalationstherapie mit Bronchodilatatoren in allen Stadien und zusätzlich inhalative Glukokortikoide bei höheren Schweregraden, vor allem, wenn es zuvor mehrfach zu Krankenhausaufenthalten infolge schwerer Infekte kam. Im fortgeschrittenem Krankheitsstadium der COPD mit Lungenemphysem und deutlichem Sauerstoffmangel (Hypoxämie) führt die Sauerstofflangzeittherapie zur Verbesserung der Überlebensrate und Lebensqualität. Insbesondere mit dem Ziel der Rekonditionierung eines nur noch gering mobilen COPD-Patienten ist der Nutzen von pulmologischer Rehabilitation nachgewiesen.
Nichtinvasive Heimbeatmung
Im Endstadium der COPD in Form der Atmungsinsuffizienz und Überlastung der Atmungsmuskulatur mit führender Hyperkapnie (PCO2 > 55 mmHg), wird zunehmend die nicht-invasive Heimbeatmung (mit einer Maske als Beatmungszugang) eingesetzt. Bei der akut respiratorischen Insuffizienz infolge exazerbierter COPD führt die nicht-invasive Maskenbeatmung im Vergleich zur invasiven Beatmung über Trachealtubus zur Verbesserung der Überlebensrate und Verkürzung des Krankenhausaufenthaltes.
Implantation von endobronchialen Ventilen
Bei bestimmter Morphologie des Emphysems führt die Lungenchirurgie mit Lungenvolumenreduktion zur objektiv messbaren und subjektiv spürbaren Verbesserung. Als eines der wenigen Kliniken im norddeutschen Raum erfolgt bei uns seit 2010 die Implantation endobronchialer Ventile in schonender, minimal-invasiver Technik mittels Bronchoskopie.
Nicht-infektiöse Entzündungen der Lunge werden unter dem Sammelbegriff "interstitielle Lungenerkrankungen" zusammengefasst. Allgemeines Merkmal dieser heterogenen Erkrankungsgruppe ist die Ansammlung von Entzündungszellen im Lungengewebe. Im Laufe dieses sich selbst unterhaltenden Entzündungsprozesses in der Lunge kommt es zur Vermehrung von Bindegewebe mit der Folge des zunehmenden Verlustes von normaler Lungenstruktur. Dadurch reduziert sich einerseits die Fläche für den Gasaustausch (weil normales Lungengewebe verloren geht) und andererseits verschlechtert sich die Belüftungsfähigkeit der Lunge. Der Endzustand eines derartigen Prozesses ist die sogenannte "Lungenfibrose". Sie stellt die Antwort des Lungengewebes auf den chronischen Entzündungsprozess im Sinne einer Wundheilung im Narbengewebe dar.
Die Beschwerden der Patienten sind unspezifisch und bestehen aus Luftnot zunächst unter körperlicher Belastung, später auch in Ruhe und / oder trockenem Reizhusten. Nicht selten vergeht ein relativ langer Zeitraum, bis die richtige Diagnose gestellt ist.
Die Diagnostik besteht zunächst in einer umfangreichen Lungenfunktionsdiagnostik. Hier zeigt sich eine Reduktion des Lungenvolumens und ein gestörter Gausaustausch.
Bildgebend wird neben dem konventionellen Röntgenbild des Brustkorbes, welches in den Frühstadien häufig keinen eindeutigen pathologischen Befund zeigt, eine Computertomographie (CT) in Dünnschnitttechnik durchgeführt. Häufig lässt sich bereits anhand der CT-Befunde eine richtungsweisende Diagnose stellen.
Des Weiteren erfolgen Spiegelungen der Bronchien (Bronchoskopie) mit Lungenspülung (Lavage), um den Anteil der Entzündungszellen in der Spülflüssigkeit zu beurteilen. In einigen Fällen ist zur endgültigen Diagnosestellung eine Entnahme von Lungengewebe im Rahmen eines kleinen operativen Eingriffs zur feingeweblichen (histologischen) Beurteilung notwendig.
Meistens bleibt die Ursache der interstitiellen Lungenerkrankungen und der Lungenfibrose jedoch unklar. Die bekannten Ursachen für diese Erkrankungsgruppe können allgemein wie folgt gegliedert werden:
- 1. Assoziation mit Systemerkrankungen des rheumatischen Formenkreis
- 2. Inhalation von Stäuben
- 3. Einwirkung nichtinhalativer Schadstoffe (Noxen)
Die therapeutischen Ansätze sind beschränkt. Wenn möglich ist die wichtigste Maßnahme das Vermeiden der Inhalation von Stäuben oder Noxe. In der Entzündungsprozess noch aktiv, dann bestehen relativ gute Aussichten auf einen Therapieerfolg mit Cortison, oft in Kombination mit anderen entzündungshemmenden Medikamenten, wie z. B. Cyclophosphamid oder Azatioprin.
Dominiert der Fibroseanteil, dann sind die genannten Medikamente meistens wirkungslos. Bei Sauerstoffmangel wird die Sauerstofflangzeittherapie begonnen. Starke Luftnot kann durch Morphinpräparate gelindert werden. In Einzelfällen kommt es zur Lungentransplantation.
Allgemeine pneumologische Sprechstunde und Privatambulanz Prof. Dr. med. Thomas Fühner, Chefarzt
nach Vereinbarung
(0511) 927 2500
Für einen Termin in der Ambulanz benötigen Sie eine Überweisung von einem Facharzt/einer Fachärztin für Pneumologie (Lungenheilkunde).
Ambulanz für Interstitielle Lungenerkrankungen Tobias Freundt, Leitender Oberarzt
nach Vereinbarung
(0511) 927 2500
Für einen Termin in der Ambulanz benötigen Sie eine Überweisung von einem Facharzt/einer Fachärztin für Pneumologie (Lungenheilkunde).
Ambulanz für Lungenempyhsem Tobias Freundt, Leitender Oberarzt
nach Vereinbarung
(0511) 927 2500
Für einen Termin in der Ambulanz benötigen Sie eine Überweisung von einem Facharzt/einer Fachärztin für Pneumologie (Lungenheilkunde).
Long COVID Ambulanz Prof. Dr. med. Thomas Fühner, Chefarzt
nach Vereinbarung
(0511) 927 2500
Für einen Termin in der Ambulanz benötigen Sie eine Überweisung von einem Facharzt/einer Fachärztin für Pneumologie (Lungenheilkunde).
Wir bieten die Covid-19 Nachsorge Ambulanz für Patientinnen und Patienten nach einem schweren Erkrankungsverlauf (z.B. mit Krankenhausaufenthalt) durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 an. Bei den Betroffenen bestehen weiterhin Beschwerden, die auf eine nicht vollständig erholte Lungenfunktion hinweisen.
Um die Abläufe so effizient wie möglich gestalten zu können, bitten wir Sie, zum Termin – soweit vorhanden – folgende Unterlagen mitzubringen:
- Alle relevanten Vorbefunde inkl. der Entlassungsberichte aus dem Krankenhaus bzw. der Reha-Klinik
- Medikamentenliste der eingenommenen Medikamente
- CDs von Röntgen- und/oder Computertomographie- (CT) Voruntersuchungen incl. Befunde
Infektionssprechstunde Tobias Freundt, Leitender Oberarzt
nach Vereinbarung
(0511) 927 2500
Für einen Termin in der Ambulanz benötigen Sie eine Überweisung von einem Facharzt/einer Fachärztin für Pneumologie (Lungenheilkunde).
Ambulanz für Schlafmedizin
Prof. Dr. med. Thomas Fühner, Chefarzt
Tobias Freundt, Leitender Oberarzt
nach Vereinbarung
(0511) 927 5340
mit Überweisung oder Einweisung nach Rücksprache mit den Mitarbeitern des Schlaflabors
Pneumoonkologische Ambulanz Dr. med. Sauerland, Anna-Lena Schmidt
nach Vereinbarung
(0511) 927 1910
Für einen Termin in der Ambulanz benötigen Sie eine Überweisung von einem Facharzt/einer Fachärztin für Pneumologie (Lungenheilkunde).
Prof. Dr. med. Thomas Fühner
Chefarzt
Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Schlaf- und Intensivmedizin
Britta Fischer
Sekretariat
(0511) 927 2500
(0511) 927 97 2500
Maria Matheis-Schönhofer
Sekretariat
(0511) 927 2500
(0511) 927 97 2500
Kathleen Behmann
Sekretariat
(0511) 927 2500
(0511) 927 97 2500
Tobias Freundt
Leitender Oberarzt, Ansprechpartner für Schlaflabor und Tuberkulose
Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Schlafmedizin
Dr. med. Klaus-Dieter Beck
Oberarzt, Ansprechpartner für pneumologische Endoskopie
Facharzt für Innere Medizin Pneumologie, Palliativmedizin und Rettungsmedizin
Jelka Meyhöfer
Oberärztin, Ansprechpartnerin für Weaningstation
Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin
Dr. med. Andrea Paul
Oberärztin, Ansprechpartnerin für Heimbeatmungsstation
Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und spezielle Intensivmedizin, Notfallmedizin
Dr. med. Isabelle Renger
Oberärztin, Ansprechpartnerin für Rauchfreiprogramm, interstitielle Lungenerkrankungen
Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie, Notfallmedizin, Palliativmedizin
Dr. med. Imke Sauerland
Oberärztin, Ansprechpartnerin für pneumologisch-onkologische Ambulanz
Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie, spezielle Intensivmedizin
Jan Schmieszek
Oberarzt, Ansprechpartner für pneumologische Intensivstation, ECMO
Facharzt für Innere Medizin, spezielle Intensivmedizin, Notfallmedizin, Weiterbildungsermächtigung internistische Intensivmedizin
Dr. med. Sebastian Fitzner
Funktionsoberarzt
Facharzt für Innere Medizin, Notfallmedizin, Klinische Akut- und Notfallmedizin, Internistische Intensivmedizin, Leitender Notarzt
Tatjana Mordkowitsch
Fachärztin für Innere Medizin
Dr. med. Andrea Peters
Fachärztin für Innere Medizin
Dr. med. Tabea Steinberg
Fachärztin für Innere Medizin
Anna-Lena Schmidt
Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie
Domenica Wuthe
Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie
Dr. rer. nat. Luisa-Marilena Gladitz
Timo Gödel
Jusra Hussain
Lisa-Christin Meise
Maik Holme
Dr. med. Kevin Poll
Dr. med. Esther Ravens
Julia Reuter
Dr. med. Jasna Simeunoivic
Sabrina Thanscheidt
Lion Wege
Dr. med. Hannah Lagarden
Sara Eileen Meyer
Felix Schönhofer
David Weigel
Die Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin blickt auf eine über hundertjährige medizinische Tradition zurück. Die Lungenheilstätte „Heidehaus“ wurde im Jahr 1907 im ländlichen Norden der Stadt Hannover gegründet und bot zunächst Platz für 120 Tuberkulosepatienten. Nach dem 2. Weltkrieg wurden zeitweise im Heidehaus mehr als 400 Patienten gleichzeitig stationär behandelt. In den 60er Jahren entwickelte sich eine moderne Spezialklinik mit eigenständigen Abteilungen für Pneumologie und Thoraxchirurgie.
Die kommunale Neustrukturierung des Klinikum Region Hannover führte dann zum Ortswechsel: Das Krankenhaus Heidehaus zog im Juni 2005 an seinen neuen Standort – das KRH Klinikum Oststadt-Heidehaus. Hier boten die Abteilungen für Pneumologie und Thoraxchirurgie in enger Zusammenarbeit mit weiteren Abteilungen des KRH Klinikums Oststadt-Heidehaus ein breites Spektrum der modernen Medizin.
Im September 2014 wurde das KRH Klinikum Oststadt-Heidehaus mit dem KRH Klinikum Siloah zusammengelegt. Im neuen KRH Klinikum Siloah-Oststadt-Heidehaus an der Ihme ist ein Krankenhaus der kurzen Wege entstanden, das die Bedürfnisse der Patienten noch stärker in den Vordergrund stellt.

